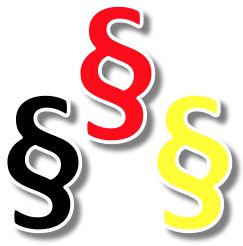
Das Bundesministerium der Justiz hat einen Entwurf veröffentlicht, der auf dem Entwurf der letzten Bundesregierung beruht und die am Genossenschaftsrecht interessierten Verbände um ihre Stellungnahme gebeten. Die Sichtweise des ZdK zur Reform ist in die Stellungnahme unseres Dachverbandes, des DGRV mit eingeflossen.
Die Reform des Genossenschaftsgesetzes 2025 steht für einen Spagat: Zwischen digitaler Modernisierung, demokratischer Teilhabe und der Bewahrung traditioneller Prüf- und Kontrollmechanismen sollen Innovation und Geschlossenheit der Rechtsform neu austariert werden. Die Stellungnahmen der Verbände belegen, wie unterschiedlich die Akteure Chancen, Risiken und Details der Reformen einschätzen.
1. Erweiterter Förderzweck: Fortschritt oder Verwässerung?
Ein Kernstück der Reform ist die geplante Erweiterung des Förderzwecks: Künftig sollen Genossenschaften ihre Mitglieder nicht nur unmittelbar (wie bisher) fördern dürfen, sondern auch mittelbar. Gerade für neue Geschäftsmodelle wie Bürgerenergie oder digitale Plattformen ist diese Öffnung laut innovativen Verbänden überfällig. Sie sorgt für Rechtssicherheit und schützt vor unsinnigen Grauzonen oder willkürlichen Deutungen. Doch längst nicht alle sehen darin einen Fortschritt: Einzelne Verbände warnen vor der drohenden Aushöhlung des Identitätsprinzips der Genossenschaft. Sie sehen die Gefahr von Schein-Genossenschaften, bei denen das eigentliche Ziel – Förderung der Mitglieder – verwischt wird.
Die einen fordern also mehr Mut zur Innovation, die anderen plädieren für einen handwerklich klareren Gesetzestext, um Fehlentwicklungen und Missbrauch konsequent zu unterbinden.
Der ZdK befürwortet die Erweiterung des Förderzweckes um eine mittelbare Förderung. Nicht nur bei Energiegenossenschaften, sondern auch bei Infrastrukturgenossenschaften kann es sein, dass eine vertragliche unmittelbare Nutzung nicht möglich ist. Wenn eine Genossenschaft ein Gebäude besitzt, das an einen oder mehrere Händler (zu guten Konditionen) vermietet wird, bei denen die Mitglieder einkaufen können, dann war bei strenger Auslegung des Prinzips der Mitgliederförderung dies nicht zulässig. Wichtig ist aber – und das sollte im Gesetzgebungsverfahren in der Begründung ggf. noch geschärft werden –, dass die vertragliche Kette vom Unternehmen der Genossenschaft hin zum Mitglied nicht zu lang oder zu theoretisch wird, weil dann eher eine rein ideelle Genossenschaft oder eine unzulässige Dividendengenossenschaft entstehen könnte. Die Stärkung der Nutzungsorientierung von Genossenschaften begrüßen wir ausdrücklich.
2. Digitalisierung und virtuelle Teilhabe: Breiter Zuspruch mit Detail-Disputen
Die neue digitale Flexibilität – von der virtuellen Gründung, über digitale Generalversammlungen bis hinein in die Textform für viele Erklärungshandlungen – erfährt breite Unterstützung. Viele Praxisakteure heben hervor, dass das Genossenschaftsmodell damit erstmals wirklich offen für ländliche, ehrenamtlich organisierte oder überregionale Initiativen wird. Die Verwaltung wird schlanker, Kosten sinken und digitale Abläufe – etwa für hybride und virtuelle Versammlungen – erhöhen die Teilhabe.
Kritische Stimmen mahnen an, dass digitale Formate Risiken der Anonymisierung, des Identitätsmissbrauchs und der erschwerten Mitgliedermobilisierung bergen. Erfahrungsberichte aus der Pandemie und die Vorgaben durch europäische Digitalisierungsrichtlinien werden dem allerdings oft als Pragmatismus- und Innovationsbeleg entgegengestellt.
Der ZdK begrüßt ausdrücklich die geplanten neuen digitalen Möglichkeiten. Den Genossenschaften werden damit moderne Wege geboten, wobei immer das Wahlrecht besteht auch weiterhin analog zu arbeiten. Die Satzungsautonomie wird so weiter gestärkt.
3. Investierende Mitglieder: Mehr Finanzierung oder Demokratie-Gefahr?
So sehr die Öffnung für investierende Mitglieder (Stichwort: Kapitalzugang und Wachstumschancen) in den Stellungnahmen begrüßt wird – bei einer zentralen Streitfrage sind sich die meisten einig: Ohne Grenzen für das Stimmrecht könnte, je nach Ausgestaltung drohen, dass große Kapitalgeber demokratische Prozesse in den Genossenschaften dominieren. Einige Verbände fordern daher eine Begrenzung von Investoren (häufig genannt: maximal 33 Prozent). Dennoch loben viele die Chancen: Neue Energieprojekte, Innovationen und selbst kleinere Genossenschaften könnten dringend notwendiges Kapital leichter beschaffen, ohne gleich ihre Struktur aufzugeben. Skepsis bleibt bei manchen Verbänden: Sie befürchten, dass mit wachsendem Kapitalanteil ein schleichender Wechsel Richtung Kapitalgesellschaften einziehen könnte – und das Förderprinzip ausgehöhlt wird.
Der ZdK begrüßt, dass auch hier die Satzungsautonomie gestärkt wird und die Genossenschaften über Grenzen selbst entscheiden können. Richtig ist, dass dafür Sorge getragen werden muss, dass das Prinzip, dass die Nutzer der Förderleistung der Genossenschaft die entscheidende Stimme haben, aufrecht erhalten bleibt. Durch die ausdrückliche Erwähnung, dass investierende Mitglieder bei Wohnungsgenossenschaften nicht gleichzeitig Nutzer von Wohnraum sein können, die in der Begründung zu Recht als allgemeiner Grundsatz beschrieben wird, stärkt dieses Prinzip. Wichtig ist daher immer zu definieren, was das Fördergeschäft ist. So können ordentliche Mitglieder von investierenden (nicht förderfähigen oder nicht nutzungswilligen) Mitgliedern abgegrenzt werden und das genossenschaftliche Identitätsprinzip (Mitglieder sind Kund/innen und Gesellschafter gleichermaßen) gestärkt werden.
4. Das Weisungsrecht: Demokratisierung oder Gefährdung der Unternehmensführung?
Die geplante Möglichkeit, Vorstände künftig auch in größeren Genossenschaften grundsätzlich den Weisungen der Mitglieder ohne harte Größenbegrenzung zu unterstellen, ist ein echter Knackpunkt. Bürgerorientierte Akteure und Demokratisierungsbefürworter begrüßen die Neuerung als Durchbruch für echte Mitgliederkontrolle. Sie sehen in der Maßnahme eine Chance, die genossenschaftliche Wirtschaft radikal demokratisch zu gestalten, Entscheidungsflauten zu vermeiden und großen Mitgliedermengen mehr Mitsprache zu ermöglichen.
Den Gegenpol bilden insbesondere die Spitzenverbände, die die Maßnahme ablehnen, insbesondere mit dem Hinweis, dass demokratische „Eingriffsrechte“ der Mitglieder für komplexe wirtschaftliche Entscheidungen in der Praxis riskant werden könnten. Die Balance von unternehmerischer Entscheidungsfreiheit und demokratischer Mitwirkung ist damit heiß umkämpft.
Der ZdK ist grundsätzlich für die Beibehaltung der derzeitigen Regel, da vielfach die bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen noch nicht ausgeschöpft sind. Nach dem Gesetz kann die Satzung nun schon die Leitungsmacht des Vorstands einschränken, auch wenn der Kern der Vorstandstätigkeit – das Tagesgeschäft – davon nicht umfasst ist. Auf der anderen Seite gibt es den Wunsch nach mehr Mitbestimmung und der Einführung von neuen Leitungsmethoden bei Genossenschaften. Aus unserer Sicht sollte grundlegend geprüft werden, ob diese Modelle auch hinsichtlich der Haftung zu dem genossenschaftlichen Modell passen.
5. Prüfpflichten, Modularität und Kostenfrage
Ein Dauerbrenner in allen Stellungnahmen ist das Prüfregime: Die Reform sieht Erleichterungen für kleine Genossenschaften und Zeitvorgaben sowie eine Checkliste für Gründungsprüfungen vor. Innovative und digitale Akteure begrüßen das ausdrücklich – sie fordern teils noch radikalere Vereinfachungen, um die Kosten zu senken und die Markteintrittshürden für neue Genossenschaften zu beseitigen. Auch die Öffnung für digitale Prüfpfade, externe oder sogar KI-gestützte Prüfungen wird als Reformbaustein gehandelt.
Kritiker warnen dagegen vor einem Reputationsverlust der Rechtsform, wenn die Prüfpflichten zu lax werden. Sie mahnen: Die bisherigen Kontrollmechanismen seien ein bewährtes Modell, das Deutschlands Genossenschaftslandschaft stark gemacht habe – und durch vorschnelle Lockerungen könnten Fehler und Skandale überhandnehmen.
Der ZdK steht für eine regelmäßige Prüfung von Genossenschaften, mahnt aber seit langer Zeit an, dass das Verhältnis zwischen dem Aufwand und dem Risiko wieder mehr in den Fokus genommen werden muss. Eine zügige Gründungsprüfung ist zu begrüßen, ebenso wie Checklisten, die an das Gericht gesendet werden, um das Geschäftsgeheimnis der Gründungsgenossenschaften zu schützen.
Fazit: Kommt jetzt der große Wurf?
Die Debatte um das neue Genossenschaftsgesetz spiegelt die Vielfalt des genossenschaftlichen Sektors: Von High-Tech über bürgernahe Energieinitiativen bis zu traditionellen Wohnungsbaugenossenschaften – alle fordern Berücksichtigung. Der Gesetzgeber steht also vor einer Gratwanderung: Modernisierung, Digitalisierung und Demokratisierung sollen zukunftsfähig handhabbar, aber kein „Freifahrtschein“ für Missbrauch und Entkernung der Rechtsform werden.
Der ZdK wird den Gesetzgebungsprozess im Sinne seiner Mitglieder beobachten und weiter begleiten.
